In einem Interview mit taff, dem Lifestyle-Magazin von Pro7 ordnet der Experte für Fake News, Christian Scherg von der REVOLVERMÄNNER GmbH, die gezielte Manipulation der Bundestagswahlen durch politische Gegner aus dem In- & Ausland ein.
Kurz vor der Bundestagswahl verbreiten sich Fake News rasant im Internet, insbesondere durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Dadurch wird es immer schwieriger, Realität von Falschinformationen zu unterscheiden.
Ein Beispiel dafür ist das Gerücht, Olaf Scholz besitze eine Luxusvilla in Kalifornien, die bei einem Brand zerstört wurde. Diese Behauptung kursierte auf TikTok, obwohl laut der Immobiliendatenbank Property Checker kein Haus in den USA auf seinen Namen registriert ist.
Auch über Friedrich Merz wurden auf X Spekulationen verbreitet – anhand nicht verifizierbarer Fotos und angeblicher Krankenakten wurde ihm eine psychische Erkrankung unterstellt. Diese Anschuldigungen sind jedoch unbegründet. Doch wer profitiert von solchen Falschmeldungen?
Gezielte Destabilisierung der deutschen Politik

Der Experte für Fake News Christian Scherg betont, dass Vertrauen eine zentrale Rolle in der Politik spielt. Wenn Menschen durch gezielte Desinformation das Vertrauen in Politik verlieren, wird der Nährboden für populistische Antworten geschaffen.
Laut Recherchen des Investigativnetzwerks Correctiv soll insbesondere Russland gezielt Desinformation im deutschen Wahlkampf streuen. Demnach wurden rund 100 Fake-News-Seiten erstellt, um Wähler mithilfe von Lügen und Deepfakes zu beeinflussen.
KI-generierte Inhalte, wie manipulierte Bilder und Videos, erschweren zusätzlich die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Fiktion. So wurde beispielsweise ein Wahlwerbespot der AfD Brandenburg mit KI-Technologie erstellt, ohne dies kenntlich zu machen. In dem Video wird eine junge Frau von einem Schwarzafrikaner bedrängt – eine Szene, die nicht real ist. Ebenso kursieren täuschend echte Deepfake-Videos, in denen Karl Lauterbach angeblich von der Polizei verhaftet oder Robert Habeck beim Arbeitsamt gezeigt wird.
Auf Anfrage, warum die AfD ihre KI-generierten Inhalte nicht entsprechend kennzeichnet, antwortete die Partei lediglich, sie werde dies erst tun, wenn andere Parteien ebenfalls ihre Wahlversprechen als möglicherweise fiktiv deklarieren.
Scherg warnt: Für viele Menschen spielt es keine Rolle, ob eine Nachricht wahr ist, solange sie der eigenen politischen Überzeugung dient oder einen Politiker ins Lächerliche zieht.
Ein weiteres Beispiel für KI-Desinformation ist „Larissa Wagner“, eine angebliche 22-jährige rechte Influencerin mit Tausenden Followern auf sozialen Netzwerken. In Wahrheit existiert sie nicht – ihr gesamtes Profil wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt.
Experte für Fake News rät: Quellen hinterfragen und Fakten kritisch prüfen
Besonders ältere Menschen haben laut Studien Schwierigkeiten, manipulierte Inhalte zu erkennen. Aber auch junge Menschen sind anfällig: Laut der PISA-Studie 2022 überprüfen viele deutsche Schüler Quellen nicht ausreichend, und nur 60 % vergleichen Informationen kritisch.
Doch wie lassen sich Fake News erkennen?
Scherg rät, entweder die Quelle der Information zu hinterfragen oder den Inhalt kritisch zu prüfen. Hinweise auf Falschmeldungen sind oft eine schlechte Bildqualität, Rechtschreibfehler oder fragwürdige Fakten. Ein Beispiel ist eine Falschmeldung über die Grünen-Politikerin Franziska Brantner, der fälschlicherweise ein Haus in den USA zugeschrieben wurde – auf TikTok war ihr Name jedoch falsch geschrieben.
Um sich gegen Desinformation zu wappnen, sind Faktencheck-Plattformen wie der ARD Faktenfinder und Mimikama hilfreich. Sie prüfen täglich Fake News und stellen Richtigstellungen online zur Verfügung.


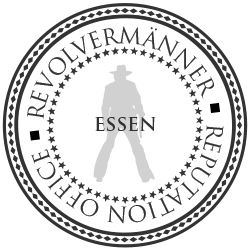

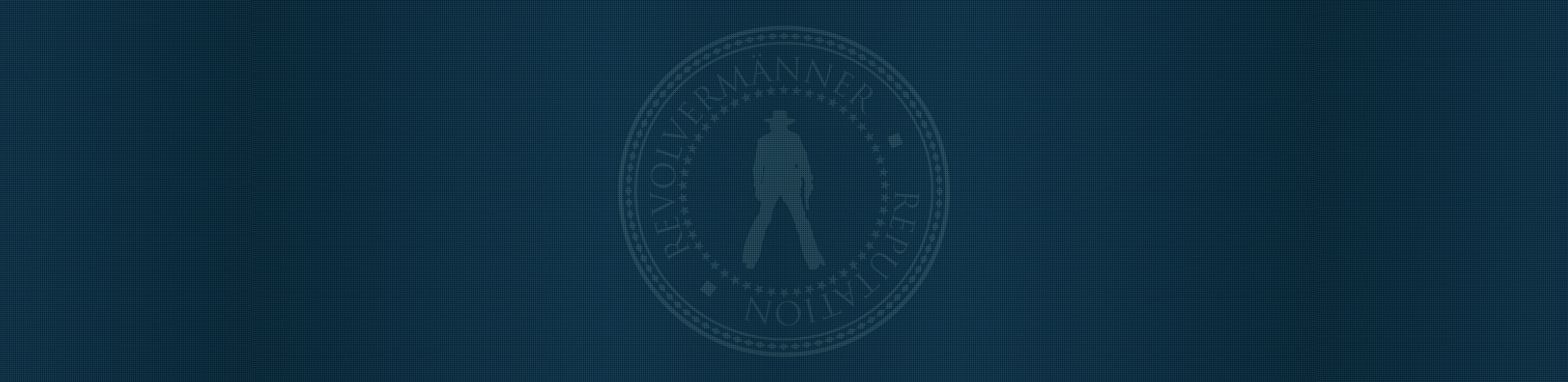
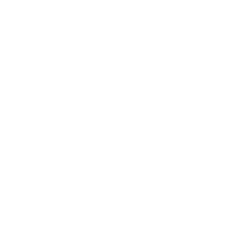 PRESSEARCHIV
PRESSEARCHIV