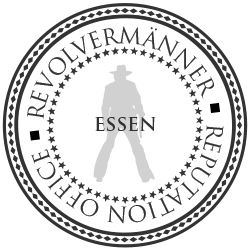Von Fotos, die nichts zeigen außer sich selbst
Ohne jedes Motiv. Anvisiert und ausgeknipst. Worauf der Sucher sich richten lässt, das Ziel wird gnadenlos abfotografiert, nachbearbeitet und umgestaltet, eingefärbt und ausgeschnitten, als Mail verschickt oder – viel schlimmer noch – im Netz geteilt. Je öfter es gespeichert wird – auf Harddisk, Flash und in der Cloud – umso statischer wird das Ergebnis. Tod durch Erstarren. Tonnen gewichtlosen Stockmaterials, deren Protagonisten uns von immergleichen Internetseiten aus den Webbaukästen entgegenlächeln, legen dafür Zeugnis ab.
Was auch immer die Linse einfängt, es zeigt eine Welt, der jedes Altern versagt bleibt. Keine Farbverfälschung ereilt die Fotos. Jeder Rot-, Blau- oder Grünstich, einst Indiz verfilmter Vergänglichkeit, lässt sich beliebig hinein- und auch wieder herausrechnen. Das Bild verbleicht nur als Kopie, wenn es auf Papier, Tassen oder Shirts fassbar wird.
Kein ungeschöntes Original in dieser Bilderwelt der digitalen Aufnahme: Automatische Bildverbesserer, Auslöser im Lächelmodus, bunte Themenfilter, lassen jederzeit und allerorts knackigscharfe, grinsefreundliche, sonnigscheinende Fotos entstehen. Die Fotoapp macht die Atomsphäre selbst, das Smartphone wird zum Skalpell: Ausgeschnitten, abgetrennt, amputiert ist die Darstellung der Realität. Die Wahrnehmung der Welt ist virtuell verpixelt. Kosmetik statt Kosmos. Unsere Authentizität erschöpft sich im Druck auf den Auslöser. Und alle haben Teil am Sterbeakt in selbstgemachter Schönheit.
Das Internet als öffentlicher Diaabend mit Käseigel, Bier und Spießern. Per Fingertipp fügen sich Bilder zusammen, werden Menschen zu Objekten, verlieren den Fokus, versenden sich per Klick in die Unendlichkeit der ungezählten Aufnahmen.
Du sollst Dir ein Bildnis machen: Das lästerliche Gebot von Flickr, Instagram und Snapchat wird zum lästigen Zwang: Der Existenzbeweis: Ich sehe, also bist Du. Das Spektrum reicht von Portraits über Gruppenfotos, Katzenbilder und Landschaftskitsch bis hin zu pseudoerotischen Entblößungen. Nur wer sich zeigt, ist da. Der Götze Selbstdarstellung fordert den Tribut: Er sieht die Welt vor lauter Bildern nicht.